Die Schweiz
Der Übergang aus Italien in die Schweiz ist am Lago maggiore ein so unmerklicher, dass man ihn nur an der Grenzsperre wahrnimmt, allenfalls noch daran, dass man in Magadino verwünschen hört, was in Mailand vergöttert wird.
Die Hochzeit wenigstens ist dieselbe in Mailand, wie in Magadino. Gleich prosaisch. "Esch isch viel abgange, isch gar ni brüütli," sagte ein allerliebstes Mädchen in Aarau, als es erzählte, dass wenige Bräute "nü de Chransch uuflege," den schönen "Chransch von dörre Blumen, weiß mit chrüne Blättere." In Magadino muss auch Vieles "abgange" sein, denn es ist nur herzlich wenig noch da. "Sposo" und "sposa" laden ihre Verwandte ein, diese begleiten, sind sie reich, zu Wagen, nach einer "colazione" im Hause der "sposa" oder im Wirtshaus, das Paar auf's Stadthaus und in die Kirche, und dann fährt es auf englische Art für einige Tage davon. Das ist Alles.
Höher hinauf im Tessin geht es feierlicher zu, schon gleich bei der Verlobung. Der Bräutigam gibt ein Geschenk. Wer das Eheversprechen bricht, muss das Andere aussteuern. Von den Verkündigungen kann man sich in einigen Orten loskaufen; wo es nicht gestattet ist, wohnt das Brautpaar ihnen nicht bei, sondern hört die Messe in einer andern Kirche. Die Hochzeit findet entweder am frühen Morgen oder am späten Abend statt, selten nach dem Gottesdienste. Ein Mittagsmahl oder Abendessen folgt, die junge Frau beschenkt ihren Mann, seine Verwandte und den Pfarrer. Getanzt wird nur ausnahmsweise, geschossen aus Mörsern.
Zu Sobrio in Livinen werden dem Bräutigam, wenn er, begleitet von seinem Paten, seinen Verwandten und Freunden, an die Tür der Braut pocht, mehrere alte Mütterchen, Bucklige oder auch wohl große Puppen angeboten. Erst nachdem er sie verschmäht, darf er eintreten und die Braut suchen. Führt er sie fort, so schließen, mit Ausnahme der Mutter, all' ihre Verwandten sich an.
In der französischen Schweiz wurde früher die Hochzeit antikpoetisch gefeiert. Vor dem Hause des Gatten stand ein großer Wagen mit der Aussteuer der Braut, obenauf ein Butterfass voll Saline und ein bandumwundener Rocken, an welchem fünf Spindeln und ein kleiner Besen hingen. Kam die Hochzeit aus der Kirche, so zogen zwei Hirten mit Dudelsäcken und ein "dgigar" mit der Violine voran; auf dem Haupt einen Kranz von Weizenähren, Eisenkrautblüten und Mistelzweigen folgte die Braut am Arme ihres Paten. Junge Leute, die sich bisher versteckt gehalten, stürzten nun hervor und drohten, die Braut zu entführen, wurden aber von den "tschermallai", den Hochzeitsburschen, zurückgetrieben. An der Tür ihres künftigen Hauses, dessen Facade mit Rosen und Ringelblumen geschmückt und dessen Schwelle mit Öl abgerieben war, fand die Braut die "bernada", eine alte Frau, welche einen Teller mit Weizenkörnern und ein Bund Schlüssel trug, dieses an dem Gürtel der Braut befestigte und von dem Weizen drei Hände voll über sie warf. Dann umfasste der junge Gatte die ihm Angetraute, hob sie leicht in die Höhe und ließ sie so über die Schwelle springen, welche sie mit keinem Fuß berühren durfte. War sie glücklich d'rinnen, so begann das Mahl (greintho). Zeigten sich Fremde in der Nähe des Hauses, so kam ein junges Mädchen heraus und lud sie zum Mitessen ein; wollten sie nicht, erschien der Vater des Neuvermählten und bat, sie möchten wenigstens im Namen Gottes und des heiligen Joseph auf die Gesundheit des jungen Paares trinken. Das junge Mädchen, welches dem Alten gefolgt war, bot ihnen auf einem Teller von Fichtenholz silberne Becher und kleine Kuchen dar, und sie brachten dann ihrerseits im Namen des heiligen Johann die Gesundheit des gastfreundlichen Greises aus.
Jetzt ist in der französischen Schweiz, im Waadtlande z. B., die Hochzeit so nüchtern, wie die
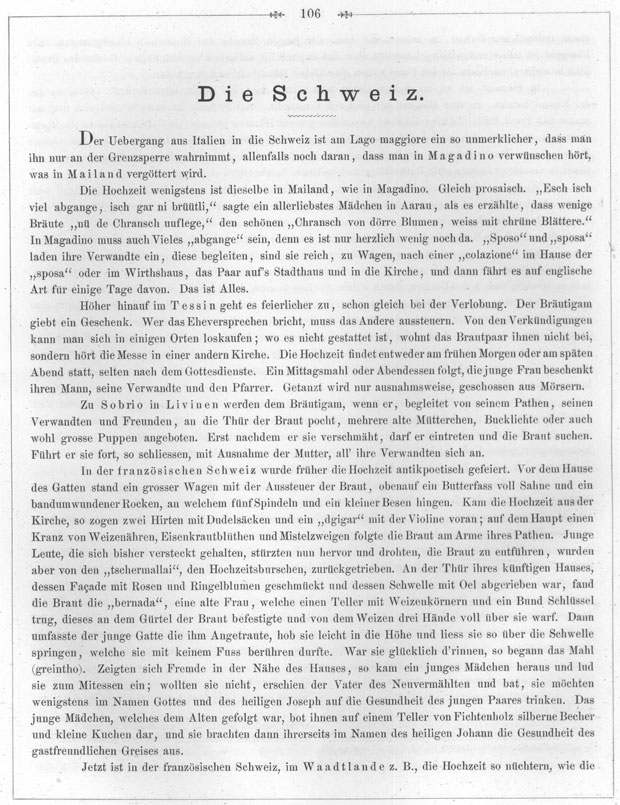
Liebesgeschichte. Diese besteht nämlich in der "fréquentation", das heißt in einer Reihe von Abendbesuchen, welche der Geliebte dem Mädchen in irgend einem abgelegenen Zimmer abstattet. Dieses Zimmer ist für die gesamte Familie während der ganzen Dauer eines solchen Besuches so gut wie verschlossen. Selbst wenn die Eltern eine Partie nicht wünschen, erlauben sie sich nicht, dem jungen Mann in seinem Kommen hinderlich zu sein, oder die Liebenden gar zu stören, das würde für die unverzeihlichste Taktlosigkeit gelten und das Mädchen sicherlich zum offenen Aufruhr treiben. Auch bei den Bällen und Gesellschaften, welche die jungen Mädchen eines Ortes und, wohlverstanden, einer Gesellschaft ihren "Messieurs" geben, sehen die Liebenden sich. Wenn sie nun so zwei bis drei Jahre hindurch den Winter vier oder fünf Mal mit einander getanzt und wöchentlich ein Mal tête-â-tête Kastanien gebraten, Nüsse geknackt und Wein getrunken haben, so steigen sie eines Morgens früh mit ganz geringer Begleitung in einen landesüblichen "char", fahren einige Stunden, lassen sich in einem entlegenen Orte oder gar in einem andern Kirchspiel trauen, und kehren dann augenblicklich in den Wohnort des Bräutigams zurück, in dessen Haus das Hochzeitsmahl stattfindet. Die Braut ist ganz weiß gekleidet, mit weißem Rosenkranz und weißem Schleier; nur wenn sie Trauer hat, ist der Schleier schwarz. Die Burschen des Dorfes haben schon den Abend vorher "für die Hochzeit geschossen" und dafür ein Geldgeschenk erhalten, welches sie zu einem Ball im ersten Cabaret oder Hotel des Ortes verwenden. Mitten aus dem Tanz ziehen sie vor das erleuchtete Haus des "Gatten" und bringen der "Gattin" ein Ständchen, wobei abermals viel Pulver verknallt und außerdem viel getrunken und Vivat gerufen wird. Ist die Ballgesellschaft zurückgekehrt, so kommt die Hochzeit, um die Artigkeit zu erwidern. Die "Gatten" voran tanzt sie paarweise herein, die "Herren" mit dem Hut auf dem Kopf, die "Demoiselles" in der schwarzen Waadtländer Seidenmütze und in schwarzen oder doch dunklen Kleidern. Sie macht erst einige Tänze unter sich, dann einige mit der Gesellschaft und kehrt darauf in das Hochzeitshaus zurück. Doch bleiben nur die älteren Mädchen ganz bei der Braut, die jüngeren ziehen sich weiß an gleich den übrigen Tänzerinnen und kommen wieder, um wirklich Teil an der Lustbarkeit des Abends zu nehmen.
Im Berner Oberland fanden früher die "Schriessete" statt, das heißt Zusammenkünfte, zu denen am Neujahrstage nach der Predigt die Burschen ihre Mädchen in's Wirtshaus abholten, und dort den Tag über bewirteten, worauf bald nachher die Bekanntschaft durch die Trauung besiegelt wurde. Ob sie verboten worden sind? Die Kantone waren immer sehr eifrig im Verbieten von Hochzeitssitten; in Freiburg z. B. wurde schon Anfang dieses Jahrhunderts das "Niedersingen" untersagt, die Sitte, das Brautpaar mit Gesang zu Bette zu begleiten und so lange harmonisch zu unterhalten, bis es sich durch Wein oder Geld ein wünschenswertes Stillschweigen erkaufte.
Ebenfalls verschwunden dürfte die Zeremonie sein, mit welcher die Braut zu Stilli an der Aare am Hochzeitsabend in das Haus ihres neuen Gatten gelangte.
Wenn nämlich der Hochzeitsschmaus im Wirtshaus seinem Ende nahe war, so entfernte sich geräuschlos der junge Ehemann mit seinen Eltern, um sich nach Hause zu begeben und dort Türen und Fensterladen auf das Sorgfältigste zu verschließen. Wenige Minuten nach ihnen kam der Brautführer, meist ein guter Freund des Bräutigams, mit der Braut ihnen nach. Er trug einen roten Rock, einen eigentümlichen Bänderhut und einen besonderen "Brautstock", mit welchem er an die Haustür der Schwiegereltern klopfte. Durch die geschlossenen Laden hindurch befragt: wer draußen sei? antwortete er: "eine Person, die gern in eurem Hause aufgenommen sein möchte." - "Das ist viel verlangt," sagte der Schwiegervater drinnen; "ist sie tugendhaft, arbeitsam, ordnungsliebend?" Der Brautführer versicherte, sie sei im Besitz dieser Eigenschaften. "Kann sie auch kochen, backen, waschen, spinnen, nähen, stricken?" wurde inwendig wieder gefragt. Der Brautführer garantierte auch diese Fertigkeiten, doch nur auf die Verantwortung der Braut, die er bei jeder Erkundigung von drinnen seinerseits draußen befragte. Sagte sie: "ich bin's," und: "ich kann's," so sprach er es ihr getreulich nach und machte höchstens einige schalkhafte Anmerkungen.

War das Examen zur Zufriedenheit des Schwiegervaters bestanden, so wurde die Haustür geöffnet, für die Braut jedoch nur, um sie in eine dunkle Kammer zu befördern, während der Brautführer sich in die erleuchtete und verzierte Wohnstube verfügen durfte, wo bereits der Schulmeister aufgepflanzt stand, um an ihn und den Bräutigam eine Rede zu richten, welche der "Brautsegen" hieß. Damit die draußen inzwischen herbeigekommenen Freunde und Nachbarn auch ihr Teil davon haben möchten, wurden alle, Fenster und Läden aufgemacht. Nach der Beendigung der Rede holte man die Braut herbei. Von selbstgebautem Wein der "Schwiegerschaft" wurde auf's Wohl der Brautleute ein Ehrentrunk gereicht; die, welche in der Stube keinen Platz fanden, erhielten ihn durch das Fenster. Mit dem Schlage zehn schnitten zwei Mädchen der Braut das Kränzchen ab und warfen es in's Küchenfeuer, der Bräutigam nahm das seinige auch ab und warf es zu dem andern, und die Gesellschaft zog aus dem Knistern der Kränze allerlei prophetische Folgerungen. Dieses Verbrennen des Kranzes geschieht auch anderweitig, z. B. in Baden, Luzern und Obwalden.
Im Freienamte wird an einigen Orten, wie zu Sarmensdorf, noch immer, wie früher allgemein, aus Apfelschalen geweissagt. Die Brautleute und die Brautführer nehmen vor dem Hochzeitsmahl Jedes sieben Äpfel und zerschneiden jeden der Äpfel in acht Stücke. Diese "Apfelschnitze" häufen sie hinter den Stühlen in Form einer Glocke auf dem Boden zusammen, schälen dann die übrigen Tafeläpfel, welche nebst Birnen den Anfang des Hochzeitsmahles ausmachen, und werfen mit diesen ganz feinen und zusammenhängenden Schalen nach den Apfelschnitzen hinter ihnen. Bilden die Schalen einen Winkel oder ein Lot, so bedeutet das Glück - liegen sie in einer Linie, wie eine Peitsche oder Geißel, ist die Lebensdauer kurz und auch noch durch Unfrieden getrübt; ergeben die Schalen gar keine Figuren, so achtet man bloß auf die, welche der Bräutigam geworfen. Liegt sie rundgeringelt, das heißt als 0, liegt sie günstig; fällt sie schlaff gedehnt als F, fällt sie unheilbringend.
Im Bezirk Baden geht am Verlobungstage die Braut, begleitet von Vater, Bruder oder Vormund, in das Haus des Bräutigams. Ihre Ankunft wird durch Böller- oder Flintenschüsse angezeigt, deren Abfeuern ein altes Herkommen der "Knabenschaft" des Dorfes zugesteht. Nachdem einige Erfrischungen eingenommen, geht es, abermals unter Schüssen, in's Pfarrhaus. Von diesem Augenblick an bis zur Hochzeit, welche vierzehn Tage darauf erfolgt, darf der Bräutigam nie mehr des Abends sein Haus verlassen, oder wenigstens nicht das seiner Braut betreten.
In diesem wird die Zeit zur würdigen Herrichtung des "Brautwagens" angewandt, für welchen wir auch die Bezeichnungen "Brautfuder" und "Brauttrossel" finden. Ebenso begegnet uns einiger Aberglaube, der sich daran knüpft. Verliert der Fuhrmann eines solchen Wagens, ohne es zu bemerken, etwas von seiner Ladung, so leben die künftigen Eheleute in Unfrieden, desgleichen wenn die Pferde nicht recht zusammenziehen.
Diese in vollkommener Übereinstimmung zu erhalten, muss in Baden noch schwerer sein, weil der Wagen da dreispännig fährt. Beim Aufladen muss die Fußseite des Bettes nach dem künftigen Wohnort der jungen Frau gerichtet sein, denn sonst würde sie, einer unglücklichen Ehe zu entgehen, bald wieder nach Hause zurückkehren. Hoch über dem übrigen Hausrat steht mit flatternder "Flachsreiste" ein Spinnrad. Der Fuhrmann trägt einen "Maien" (Strauss) auf dem Hut, den Pferden prangen sie vor der Stirn. Draußen auf der Straße wartet das ganze Dorf auf den Wagen, die Kinderschar besonders auf den Bräutigam, welcher für einige Franken kleine Münze in der Tasche hat und davon unter sie auswirft. Älteren Personen, die ebenfalls auf eine solche Erinnerung Anspruch machen, drückt er das Geldstück in die Hand. Hat das junge Paar etwa Neider und Feinde, so werfen sie in Papier gewickelte Kirschsteine unter die Kinder, welche natürlich den Bräutigam dieser Täuschung beschuldigen und ihm dafür Böses nachreden. Ja nicht knausern darf er gegen die jungen Burschen, welche ihn am Ende des Dorfes vor einer über den Weg gespannten Kette mit Brot und Wein erwarten. Weigert er sich, seine Braut "bei der Knabenschaft auszukaufen," so lässt man ihn zwar nach einigem Hin- und Herreden frei durch, aber man greift augenblicklich

zu den bereitgehaltenen Stutzen, so rasch wie möglich knattert Schuss auf Schuss, und Nichts ist für den Bräutigam beschimpfender, als dieses "Fortschiessen" seiner Braut.
An andern Orten kommt am Sonntag vor der Hochzeit, die am Dienstag gefeiert wird, der Bräutigam mit dem Schreiner, welcher die Aussteuer verfertigt, in das Haus der Braut, um nach der gehörigen Stärkung durch Speise und Trank die "Uniformierung des Brautfuders" zu besorgen. Das Brautbett wird auf dem Wagen selbst von der "Gspiel" (dem Brautmädchen) und einer Näherin "uufgerüschtet" und an der Decke mit roten Bändern versehen, die lustig im Winde flattern. Die Mähnen und Schweife der Pferde sind ebenfalls "rotgezöpft", wenn der Bräutigam nicht Müller oder Bäcker ist, denn sonst nimmt man blaue Bänder. Auch die Kunkel, welche zwischen Bett und Kommode steht, hat ein buntes Band, den höchsten Glanz aber verleiht dem Brautfuder ein funkelnder, ganz neuer kupferner Kessel. Hinter dem Wagen geht der Schreiner mit seinem Hammer, dann kommen Bräutigam und"Gspiel". Hat der Bräutigam die Stangen und Seile, welche er auf seinem Wege findet, durch Zahlen bei Seite geschafft, ist er in seinem Dorfe gehörig durch Böller- und Flintenknallen empfangen worden, so wird von Schreiner und "Gspiel" das Abladen und Einräumen der Sachen besorgt, dann gibt es Kaffee und Küchel, und darauf muss der "Gsell" mit dem Hochzeiter das Bett einweihen, damit durch ein Schnarchduett die bösen Geister sowie Ratten und Mäuse auf immer von dem Lager der künftigen Eheleute verscheucht werden mögen. In Baden, wo der Bruder des Bräutigams den Gesellen macht, findet diese Verpflichtung nicht statt.
Zum Brautführer wählt in Baden der Bräutigam seinen "Firmpaten", die Braut zur Gespielin ihre Schwester und die Firmpatin zu der sogenannten "gälen" (gelben) Frau, die Ehrenmutter bei der Hochzeit, die als anordnende Zeremonienmeisterin wohl auch die "Frau G'schäftige" benannt wird. Das Prädikat der "gelben" Frau wird von der Ostara und ihrem Brautschuh abgeleitet. In Unterwalden heißen Brautführer und Brautführerin "der gäle Götti" und "die gäle Gotte", während im oberen Freienamte die "gelbe Gotte" wieder die gelbe Frau bezeichnet, welche Muskatnüsse in den "Brautwein" schabt und der Braut beim vorletzten Tanze die Weiberhaube aufsetzt, worauf das Brautpaar mit dem letzten Tanz, dem "Kränzleinabtanzen", das Fest beschließt.
Im Bezirk Baden holt der Brautführer die Braut bei den Eltern ab, indem er an diese eine passende Anrede hält und der Mutter zum Abschied ein Fünffrankenstück verehrt. Sobald der Brautzug auf der Straße ist, kommen die armen Leute und die Kinder des Dorfes in das Brauthaus zur Morgensuppe. Auch im Haus des Bräutigams wird diese Gastfreundschaft ausgeübt.
Gewehrsalven und Musik begleiten den Zug und schweigen nur so lange, wie er in der Kirche ist. Nach dem Hochzeitsmahl überreicht die Gespielin im Auftrage der Braut jedem Gast ein Taschentuch, wofür Jeder sich zur Braut verfügt, ihr ein Geldgeschenk macht und dafür von ihr ein Glas mit besserem Wein empfängt. Diese Zeremonie heißt "das Gaben".
Die "gelbe Frau" nur schenkt kein Geld, sondern ein Leintuch. Nachdem das Brautpaar drei Touren allein getanzt, nimmt sie der Braut den Kranz ab und wirft ihn in's Herdfeuer. Verbrennt er rasch, ist es ein glückliches Zeichen; ein schlimmes dagegen ist es, wenn er sprüht und "glyset" (langsam verglüht). Die Neuvermählte heißt jetzt nicht mehr Braut, sondern Frau. Die "Knabenschaft" schießt noch bis tief in die Nacht hinein und wird dafür am nächsten Tage vom Bräutigam mit einem Trunk bewirtet.
Das langsame Verglühen des Kranzes wird auch in Obwalden als ein bedenkliches Zeichen betrachtet, darum schüren die Braut und die "Gelbe" das Feuer gern etwas stark an und beten kniend, während der Kranz drinnen liegt, um einen glücklichen Ehestand.
Was man in Obwalden auch noch fürchtet, das sind Geschenke von schneidenden Dingen zwischen Verlobten; man sagt wie im Norden: sie zerschneiden die Liebe. Ist die Hochzeit von der Kanzel verkündet,
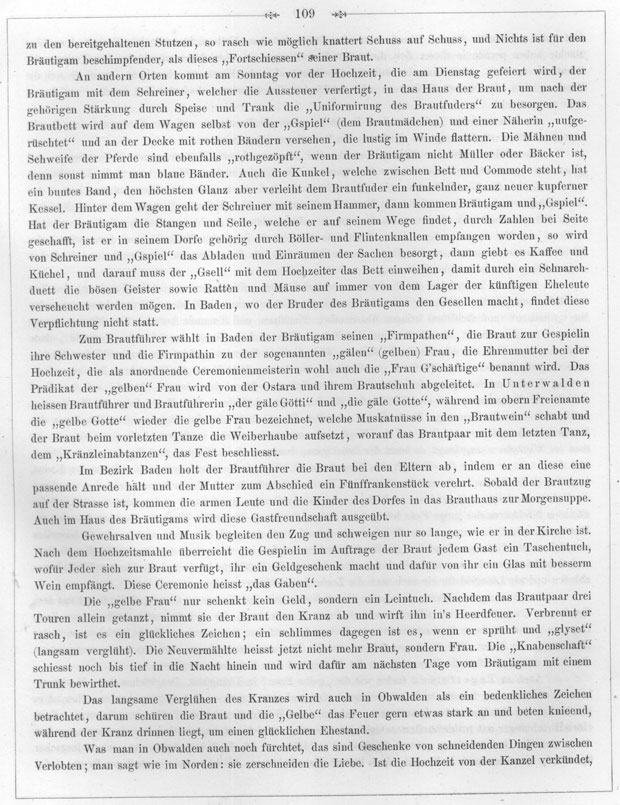
darf "die verkündete Person Abends nach der Betglocke ohne Not nicht mehr in's Freie," denn böse Mächte haben gerade in dieser Zeit die meiste Gewalt über sie. Am Altar müssen bei der Trauung die Brautleute so dicht neben einander knien, dass Niemand in der Kirche es sehen kann, wenn sie sich die Hände reichen. Das Schwächerbrennen oder Auslöschen der Altarkerze bedeutet Tod für den, auf dessen Seite es geschieht.
In Luzern droht Tod oder doch Unglück, wenn die Brautleute auf dem Kirchgang einer Leiche begegnen. Nicht minder zeigt das Verlieren des Brautringes kurze Ehe an.
Brautführer und Brautführerin werden im Luzerner Land "Vorbrüüggen" (Vorbräutigam) und "Vorbruut" genannt, weil sie vor dem Brautpaare in die Kirche ziehen. Dieses besorgt die Einladungen, und beschenkt die Einzuladenden mit einem "Nastuch" und einem "Meieli" (Blumensträußchen). Am Nachmittag vor der Hochzeit findet im Hause des Bräutigams die "Kränzlete" statt, indem die Mädchen seiner Bekanntschaft sich dort versammeln, um die "Blumenbüsche" zu binden, welche die Hochzeitsgäste an Brust und Hut tragen sollen. Nach dieser hübschen Arbeit folgt eine Mahlzeit, und dann trägt jedes Mädchen einem der geladenen Jünglinge, den es lieber sieht, als die andern, in einem verdeckten Körbchen einen solchen Strauss in seine Wohnung.
Die Zeit, in welcher die Hochzeiten vorzüglich gern gefeiert werden, ist der Fasching, der Tag war früher ein "Zistig" (Dienstag) oder Donnerstag, jetzt ist es immer ein Montag. Mörserschüsse verkünden ihn, "Chaisen" und Schlitten bringen Verwandte, Nachbarn und Freunde herbei. Die Männer tragen "Maien" im Knopfloch, die Weiber auf den Hüten. Eine tüchtige Suppe erquickt als "Vormahl", dann folgt man dem Rufe der Glocken in die Kirche. Die "Gelbe", ihrerseits gefolgt von den weiblichen Gästen, schreitet, ein Körbchen mit Tüchern und Sträußen am Arme, dicht hinter der Braut her. In einiger Entfernung kommt an der Spitze der Männer der Bräutigam, welcher einen langen Mantel, auf den Kopf geklebt ein Kränzchen, und den Hut in den Händen trägt. Auf die heilige Messe folgt ein Musikantentusch und dann die Trauung. Nach dieser schneidet die "Gelbe" mit einer Schere dem Bräutigam das Kränzchen ab und versetzt ihm auf den Kopf einen mehr oder minder kräftigen "Andenkensschlag". Ist man im Wirtshaus angelangt, so tanzt der Bräutigam, immer noch im Mantel, drei Touren mit der Braut, und dann tritt er sie der Gesellschaft zum Ehrentanz ab. Die "Gelbe" verlangt von der Braut den Kranz, trägt ihn in die Küche, verbrennt ihn, bietet bei Tische Schnupftücher als Hochzeitsgeschenke dar, empfängt die Gaben der Gäste und schließt endlich, nachdem zur Genüge geschmaust und getanzt worden und die nächsten Nachbarn das junge Paar heimgeleitet haben, im neuen Hause die Tür zur Hochzeitskammer zu. Wir setzen nämlich voraus, dass die Hochzeit normal verlaufen und die Braut nicht, wie es bisweilen geschieht, dem Bräutigam und der "Gelben" gestohlen worden ist, denn sonst ergibt sich für die "Gelbe" und den Bräutigam das beschämende Intermezzo, dass sie die Entführte in einem benachbarten Wirtshaus abholen und als Lösegeld für sie auch noch die Zeche der Entführer zahlen müssen.
Bei Baumgarten hatte die "gelbe Frau" Nichts mit dem Kranz zu tun, weil die Braut auf dem Kopfe nur einen Strauss von silbernen und goldenen Blumen trug, der sich für immer aufbewahren ließ. Dagegen musste sie beim Hochzeitsmahl von Zeit zu Zeit mit dem feinen weißen Tuch, welches sie in der Hand trug, der Braut über die Augen fahren, um die Tränen abzutrocknen, von denen man voraussetzte, die Braut müsse sie über die Trennung von der Mutter und dem Vaterhaus vergießen.
Auch zu Tegerfelden finden wir die "gelbe Frau" in Tätigkeit. Desgleichen den "Hochzeitslader", welchem wir bereits mehrfach begegnet sind und später noch so oft begegnen werden. Hier ist es gewöhnlich der Taufpate des Bräutigams, welcher diese Würde übernimmt. Früher trug er an der Seite einen Hirschfänger mit rotbebändertem Griff, jetzt begnügt er sich mit einem roten Regenschirm unter dem Arm. Am Hut hat er einen großen Strauss mit Goldflittern. Die Einladung hält er in "schriftdeutscher Sprache", bisweilen auch in Versen, doch kommt das selten vor. Bleibt er bei vernünftiger Prosa, ladet

er "die lieben Freunde und Nachbarn freundlich und in aller Form ein, so viel ihrer können, am nächsten Dienstage zum Morgenmahl in eines der Wohnhäuser der beiden Verlobten zu kommen und dann zur feierlichen Einsegnung in die Kirche zu gehen. Nach dem Gottesdienste wartet ihrer eine bestellte Mahlzeit nebst Tanz. Am Schlüsse des festlichen Tages wird sich's dann der Hochzeiter zur Ehre rechnen, wenn ihr den Trunk Wein, den er euch in seinem Wohnhaus anbietet, freudig annehmen werdet. Im Übrigen wünscht euch das ehrenwerte Brautpaar der Erde schönstes Glück und des Himmels seligen Frieden." Da jeder Gast für seine Rechnung isst und tanzt, so zeigt der Hochzeitslader zum Schlüsse seiner Rede an, wie viel die "Uerte" (Rechnung) im Wirtshaus betragen werde, und dann trinkt er ein Glas Wein. Hat er das in ungefähr sechzig Häusern getan, so ist er ein wenig "schwer".
Am Montag vor der Hochzeit kommen der Braut Freundinnen zu ihr in's Haus, um zu"schäppelen", das heißt die bunten "Maien" und die roten Taschentücher für die Hochzeitsgäste zurechtzumachen. Anwesend sind der Hochzeiter, der Hochzeitslader, der "Gsell", die"Gspiel", die beste Freundin der Braut, und deren Patin, welche auch hier die "gelbe Frau" vorstellt. Der Hochzeitslader schenkt der Braut ein Tischtuch, der Hochzeiter aber nicht, wie zu Rudolfstetten im Freienamte, der Braut, sondern der "Gspiel"und dem "Gsell" neue Schuhe. Alle gemeinschaftlich ordnen die Festlichkeiten des nächsten Tages.
Diese beginnen mit der Morgensuppe, welche, aus Suppe, Fleisch und Wein bestehend, den Geladenen in den Häusern der Brautleute geboten wird. In dem der Braut machen der "Gsell" und die "gelbe Frau", in dem des Bräutigams die "Gspiel" und der Hochzeitslader die Wirte. Das Anheften der Maien und das Überreichen der Tücher besorgt nach dem Essen die "gelbe Frau", welche dafür von jedem Gast mit Geld belohnt wird. Im Hochzeiterhaus wird beides durch eine Näherin versehen.
Darauf erscheint mit den Musikanten der Hochzeitslader, um die Braut zu holen, diese jedoch verschließt sich in ihre Kammer und will vom Geholtwerden Nichts wissen. Der Hochzeitslader begibt sich also zu der Mutter, die ihm vernünftiger zu sein scheint, fordert ihr in äußerst wohlgesetzten Worten die Tochter ab, und übergibt ihr ein Silberstück, welches "der Schlüssel zur Brautkammer" heißt. Die Mutter rechtfertigt das Vertrauen des Hochzeitsladers und gibt die Tochter heraus. Die Musik pfeift und geigt ihren alten Hochzeitsmarsch. Die Glocken läuten, aus beiden Hochzeitshäusern treten die Gäste geordnet auf die Straße; voran Hochzeiter und "Gspiel", Braut und "Gsell", geht es in die Kirche, und während dort die Trauung vollzogen wird, holen sämtliche arme Kinder des Dorfes sich im Brauthaus Fleisch und Brot als "Morgensuppe".
In derselben Ordnung, wie er in die Kirche gezogen, begibt der Zug sich nach der Trauung in's Wirtshaus, wo bis um zehn Uhr gegessen und getanzt wird. Dann findet die "Gäbete" statt, das heißt jeder Gast trinkt aus einem "Chrüseli" (Krüglein), welches die Braut kredenzt, etwas Rotwein, in den Muskat gerieben worden ist, und vergilt diesen Schluck der Braut durch Segenswünsche und ein Geschenk. Auf die "Gäbete" folgt das "Schäppeliabtanzen". Braut und Hochzeiter tanzen drei Tänze, wobei die Braut zum letzten Male "das Schäppeli", das bunte Festkränzchen der Unverheirateten, trägt, denn beim dritten Tanze nimmt die "gelbe Frau" es ihr ab, verbrennt es jedoch nicht, sondern übergibt es in einem neuen Körbchen einer Schwester der Braut zum Nachhausetragen.
Hierauf setzt die ganze Gesellschaft sich abermals zum Essen nieder. Die Braut darf jedoch die ihr vorgelegten Speisen nicht selbst zerschneiden, sondern muss es von der "gelben Frau" tun lassen. Der Schullehrer hält die "Abdankungsrede", wofür er die halbe "Uerte" frei hat. Und nun zieht man in's Haus des Hochzeiters. Wie man es anfängt, um noch essen und trinken zu können, ist schwer zu begreifen, aber Tatsache ist es, dass Alle noch die Fähigkeit haben, eine "letzte Leibesstärkung" zu sich zu nehmen, dass mächtige Kannen mit Kaffee wieder und wieder leer werden, und wahre Gebirge von "Chüechli" (Küchelchen) verschwinden.
Bei Freienämter Hochzeiten wird der gewärmte Wein erst nach dem Hochzeitstanz gereicht und
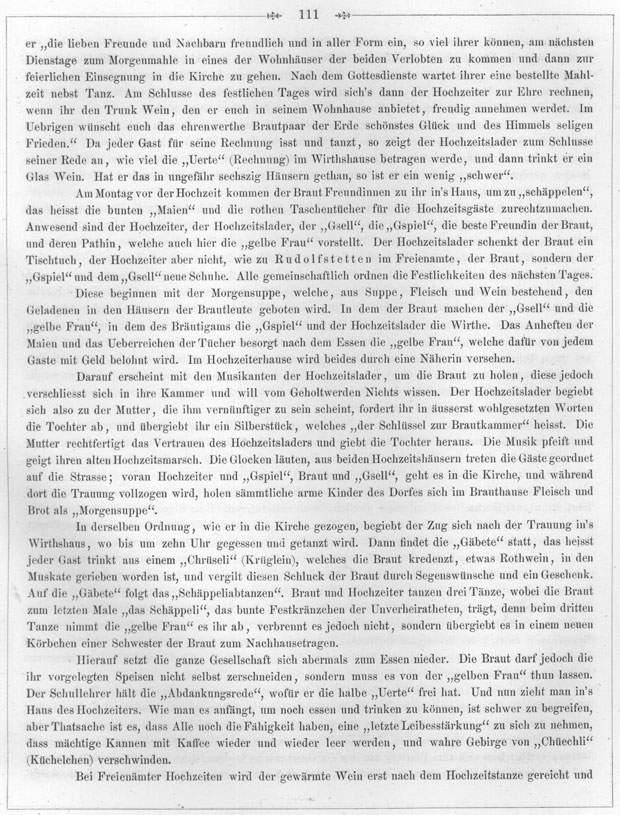
durch ein Geschenk erwidert. Vor dem Hochzeitstanz findet hier und da ein Tanz statt, welchen der Älteste und die Jüngste in der Gesellschaft eröffnen, so dass man ein sechzehnjähriges "Töchterlein" mit einem Siebziger "auftanzen" sehen kann. Beim Brautmahl war es im Freienamt früher üblich, dass der Bräutigam der Braut gegenüber saß und nur von Zeit zu Zeit aufstand, um sie zu bedienen. In Zürich mussten die Brautleute mit demselben Messer essen und aus demselben Glas trinken.
Das Einladen geschieht je nach den Gegenden durch verschiedene Personen. In Schaffhausen tut es des Bräutigams Schneider. Die Hochzeit dauert zwei Tage. Die eingeladenen Frauen haben das Recht, eine von ihnen gewählte "Tafeldame" zu Schmaus und Tanz mitzubringen. Während des Mahles werden die Gäste mit "Uertten" erfreut, welche aus scherzhaften Devisen und halb anzüglichen Geschenken bestehen.
Im oberen Thurgau überbringt bei den "Evangelischen" der Schulmeister die Einladungen. Auch am Hochzeitsmorgen begleitet er den Bräutigam und den Gesellen in's Brauthaus und begehrt nach dem Frühstück in feierlicher Rede die Braut für den Bräutigam, dessen Tugenden er unermesslich "hervorstreicht". Ein Gegenredner tritt auf und entwickelt Bedenklichkeiten: die Braut ist einzig, kann nicht entbehrt werden u.s.w. Es wird unterhandelt, gebeten, allenfalls auch geweint, zuletzt aber nur noch gedankt, denn die Angelegenheit ist in Ordnung, und man folgt dem voranziehenden Fiedler in die Kirche. Beim Mahle senden Verwandte und Freunde dem Brautpaare und den Gästen kleine Geschenke oder "Chräme", welche vorgezeigt und belacht werden. Die Zeche bezahlt bald der Bräutigam, bald der Gast; dieser schickt an manchen Orten, was er auf dem Teller lässt, als "Chram" nach Hause. Die Braut darf Nichts auf ihren Teller nehmen, sondern nur heimlich gemessen, was der Geselle ihr zusteckt, muss sich aber sehr in Acht nehmen, dass er ihr nicht den Schuh stiehlt, denn sonst wird sie nebst dem Bräutigam ausgelacht. Nach dem Essen empfiehlt der Schulmeister den Gästen, das Brautpaar mit reichlichen Gaben zu bedenken, welche die Braut dann entgegennimmt.
Bisweilen lässt man sich, wie im Waadtlande, ganz still in einer Kirche außer der Gemeinde trauen. Innerhalb dieser ist eine Trauung ohne Sang und Klang eine Ehrenstrafe, und der Mittwoch als "kein Tag" der Tag der Ehrlosen. Bei den "Evangelischen" wird die Hochzeit am Dienstag und Donnerstag, bei den "Katholischen" am Montag gefeiert.
Auch in Zürich lässt man sich gern außerhalb der Stadt an einem beliebigen Orte trauen und fährt dann zum Hochzeitsfest an einen zweiten, noch entfernteren. Eine Eigentümlichkeit ist es, dass die ganze Gesellschaft selbst bei der größten Hitze bis an den Ort der Trauung in verschlossenen Wagen fahren muss. Erst wenn man wieder abfährt, dürfen die Wagen zurückgeschlagen werden.
Im katholischen Kreise Zurzach gehen die Verlobten an einem Samstage zum Ortspfarrer, um sich vor Zeugen zur "Proklamation" zu melden. Ist der Pfarrer kein Geizhals, so bewirtet er nach vollzogenen Sponsalien Brautpaar und Zeugen mit einigen Maß "Gutem", wofür beim Fortgehen das Trinkgeld für die Köchin sich auch als ein "gutes" erweist. An manchen Orten heißt der "Wirtshausgang" nach der Verlobung beim Pfarrer "das Jungfernvertrinken", und wiederum wird am Abend des Tages, wo "die Brautfuhre" fährt, "der Bräutigam vertrunken", indem seine sämtlichen noch ledigen Schulkameraden im Wirtshaus seine Gäste sind, eine Bewirtung, die sie ihm beim "Kirchgang" durch Krachen von Böllern und Pistolen lohnen.
Im Kanton Glarus fährt im Sernftal der Bräutigam schon am Abend vor der Hochzeit seine Braut nebst ihrer gesamten Habe in seine Behausung, von wo Beide, er mit einem Strauss, sie mit dem Kranz geschmückt, am nächsten Morgen abgeholt und in die Kirche geleitet werden. Anderswo gibt es im Hause der Braut eine Morgensuppe. Nach der Trauung, welcher die Vermögenden eine Predigt vorangehen lassen, verfügt man sich zum Pfarrer, um ihm ein Geschenk zu bringen, dann zu den Verwandten, um sie auf den Abend zum Hochzeitsmahl einzuladen. Am nächsten Sonntage geht das Ehepaar im Hochzeits-

schmuck in die Kirche, um sich der Gemeinde zu zeigen. Doch früher durften nur die Bräute sich so im Glanze zeigen, welchen Nichts nachzusagen war: Entehrte durften laut Eheordnung bei Strafe weder "Schäppeli", noch Haarband tragen, sondern mussten "in aller Einfältigkeit, ohne Vorgänger und einige Pracht, zur Kirche gehen." In Luzern war man noch strenger, denn da sagte man sogar: ein gefallenes Mädchen, welches den Kranz der Jungfrauen trüge, beginge so viele Sünden, wie Blumen in dem Kranz wären.
Das Sperren des Weges durch Seile, Ketten und Schlagbäume wird an den verschiedensten Orten ausgeführt, und zwar nicht bloß, wenn der Hochzeiter mit seiner neuen Frau aus dem Weichbild ihres Heimatortes zieht, sondern häufig schon, wenn er mit ihr aus der Kirche tritt oder zum Schmause in das Gasthaus zu gehen beabsichtigt, bei welchen Gelegenheiten es dem Brautführer obliegt, das Trinkgeld auszuwerfen. Den Gebrauch, falsche Bräute unterzuschieben, bemerken wir noch ein Mal im Bündner Rhamserthale, wo die Braut, wenn sie von einem der Geladenen für den Bräutigam, seinen Freund und Herrn, gefordert wird, um ihn in die Kirche zur Trauung zu begleiten, sich versteckt hat und erst gesucht werden soll. Zwei Mal müssen alte arme Frauen sich statt ihrer der schimpflichsten Zurückweisung aussetzen, beim dritten Male erst kommt sie selbst, aber nicht ohne dass der Redner, welcher von ihrer Partei ist, ihren Wert gewaltig anpreist und für sie die prächtigsten Brautgeschenke fordert. Nebenbei geschieht das Alles nicht im Mai, indem man auch in der Schweiz den Monat der Eselsliebe für unglücklich hält. Für desto glücklicher gilt der "Hornung", in welchem "die Katzen verliebt sind."

